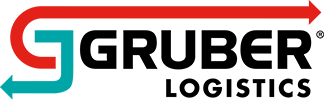Beim Blick auf die Schlagzeilen scheint es, als ob die Zukunft des elektrischen Schwerlastverkehrs direkt vor der Tür steht: verfügbare E-Lkw auf dem Markt, digitale Werkzeuge zur Leistungsüberwachung von E-Lkw und ultraschnelle Ladestationen werden regelmäßig in der öffentlichen Diskussion erwähnt. Die weit verbreitete Einführung von Elektroautos hat viele dazu gebracht zu glauben, dass auch der großflächige Einsatz von Elektro-Lkw in greifbarer Nähe des Marktes liegt. Allerdings stellt die Nutzung eines Elektro-Lkw weit größere Herausforderungen dar, von denen viele heute noch ungelöst sind.
Der Mangel an Ladeinfrastruktur an strategischen Punkten im Transportnetz, die Notwendigkeit hoher Leistung und ausreichendem Platz zum Aufladen von Schwerlastfahrzeugen, ganz zu schweigen von der Leistung sowohl der Lkw als auch der Ladesysteme – die stark von Umwelt- und geografischen Bedingungen abhängt – sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Logistikunternehmen derzeit gegenübersehen.
Um dieses Problem anzugehen, ergreifen einige Logistikbetreiber direkte Maßnahmen, um die Infrastruktur-Lücke zu schließen. Gruber Logistics ist eines dieser Unternehmen und hat bereits zwei Ladestationen für Schwerlast-Lkw in Deutschland aktiviert, die strategisch in Staufenberg entlang des skandinavisch-mediterranen Korridors und in Köln im Kern des Rheintals entlang der wichtigsten europäischen Güterverkehrsrouten gelegen sind.
Neben den praktischen Initiativen vor Ort engagiert sich Gruber Logistics seit Jahren in der Forschung und Entwicklung technologischer Lösungen zur Dekarbonisierung, darunter das europäisch kofinanzierte Projekt FLEXMCS. Das Projekt Flexible Megawatt Charging Systems zielt darauf ab, Prototypen von Hochleistungs-Ladesystemen (Megawatt-Ladegeräten) zu entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse des Güterverkehrs zugeschnitten sind. Das Projekt zielt nicht nur darauf ab, die Leistung und Geschwindigkeit des Ladens zu erhöhen, sondern auch das physische Layout der Infrastruktur neu zu definieren, um es mit den betrieblichen Anforderungen der Straßenlogistik kompatibel zu machen.
Derzeit sind die meisten Ladestationen nicht für Lkw geeignet. Es gibt nicht genug Platz zum Manövrieren oder Parken, und die verfügbare Leistung ist oft nicht ausreichend. Darüber hinaus ist die tatsächliche Ladegeschwindigkeit aufgrund des Mangels an dedizierten Infrastrukturen meist langsamer als erwartet. Beispielsweise könnte eine Station, die für das Laden mit 350 kW ausgelegt ist, viel langsamer laden, wenn die Leistung mit anderen Fahrzeugen geteilt wird oder aufgrund von Netzbeschränkungen. Während dies für Autofahrer ein geringfügiges Problem darstellen könnte, kann es erhebliche Störungen in den Logistikabläufen verursachen.
FLEXMCS, geleitet von der Vrije Universiteit Brussel, geht diese Probleme an, indem es ein neues Lademodell vorschlägt, das von Anfang an für den Schwertransportsektor konzipiert ist. Das Projekt umfasst große Industrieakteure wie DAF, IVECO, Bosch, Alpitronic Energy und Gruber Logistics als einzigen Logistikpartner, der für die Unterstützung der Entwicklung der 1,2 MW-Ladestation und deren Test mit eigenen Lkw innerhalb von maximal 45 Minuten während der Fahrerpause verantwortlich sein wird. Das Projekt erhält Unterstützung von der Europäischen Kommission mit einer Gesamtfinanzierung von 8,76 Millionen Euro.
Dieser Bottom-up-Ansatz steht im Einklang mit den breiteren Innovationsbemühungen, die von ALICE – der Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe, einem Partner des Projekts, gefördert werden. Als führende europäische Plattform, die Industrie, Forschung und politische Akteure zusammenbringt, spielt ALICE eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Zusammenarbeit und der Beschleunigung der Einführung nachhaltiger und intelligenter Logistiklösungen auf dem gesamten Kontinent.
Mit diesem Projekt gestaltet die Logistikbranche die Zukunft der Energiewende!
Diese Infrastrukturinitiativen gehen Hand in Hand mit einem umfassenderen Plan zur Elektrifizierung der Flotte: Gruber Logistics hat bereits mehrere Elektrofahrzeuge in Deutschland und Italien in Betrieb genommen, mit dem Ziel, den Güterverkehr nicht nur emissionsarm, sondern völlig emissionsfrei zu gestalten.
Hier finden Sie weitere Informationen zu EU-Projekt FLEXMCS.